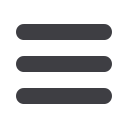
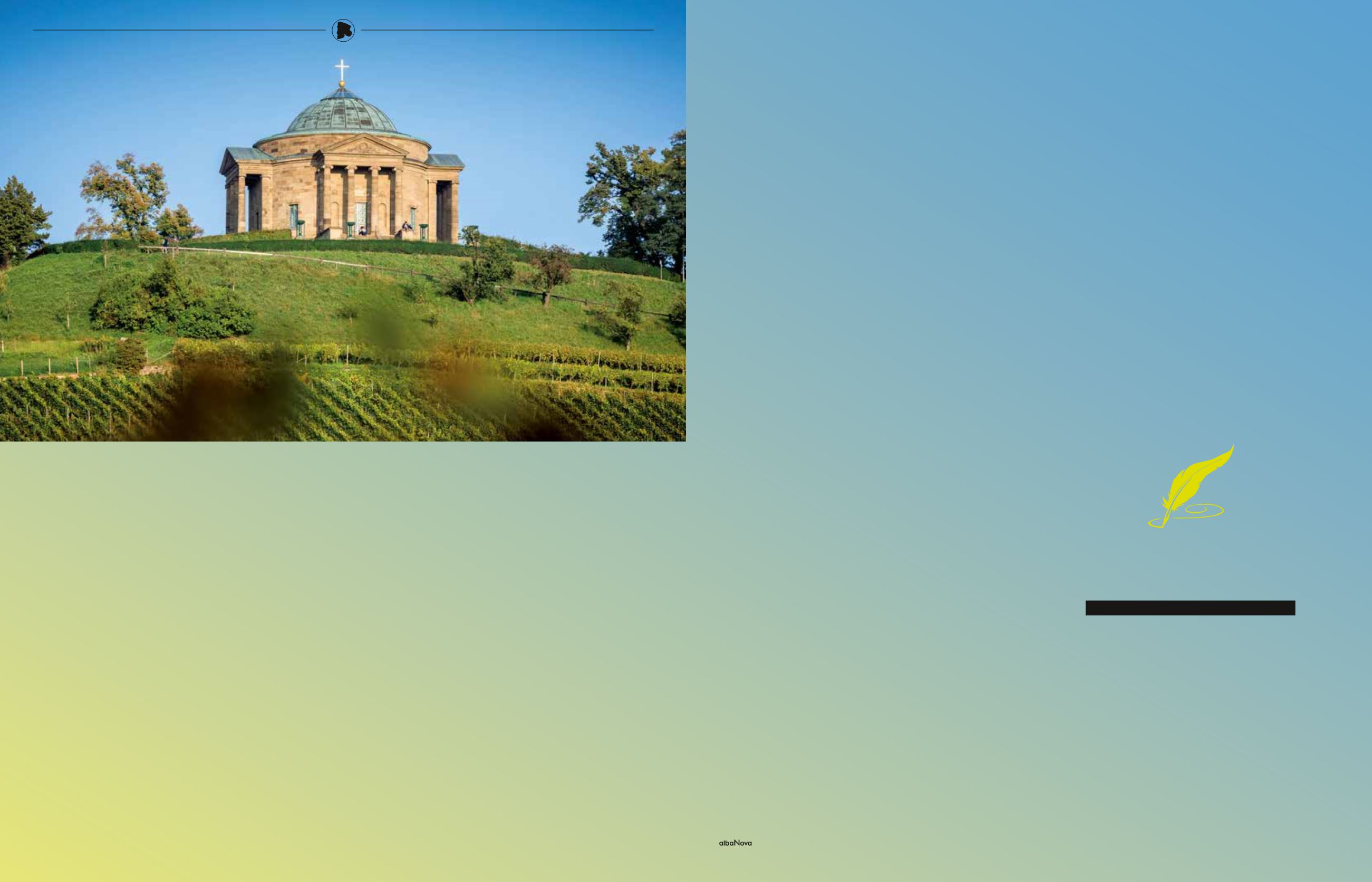
41
2018
Kulturfahrten
ge verschiedener Stämme, die aus der Not oder Lust amAbenteuer oder
Aussicht auf Beute mit ihm nach Süden aufgebrochen waren. Sie kamen
wahrscheinlich aus dem Gebiet der Ostsee, die die Römer „Mare Su-
ebicum“ nannten. Auch der Mann von Osterby, dessen Schädel 1948
bei Eckernförde in Schleswig-Holstein gefunden wurde, war ein Su-
ebe, erkennbar am schwäbischen Haarknoten. Laut Tacitus kämmten
sich die Krieger des germanischen Stammes der
Sueben die Haare seitwärts und banden sie auf
dem Scheitel zu einemKnoten hoch. Der Sinn des
Knotens habe darin bestanden, in der Schlacht
größer und furchteinflößender zu erscheinen. Ob
Tacitus schon eine Art Schwäbisch sprach?
Schwaben zwischen Genf und
Wittenberg
Das diesjährige Jubiläumsjahr der Reformation
trägt viel zum Verständnis der heutigen Schwaben
bei. Es heißt, Schwaben liegt religiös gesehen in
der Mitte zwischen Wittenberg und Genf. Cal-
vins Regiment in Genf lieferte die Vorlage für die Kehrwoche, die die
„Reigschmeckte“ (Neuzugezogene) fassungslos zur Kenntnis nehmen.
In Genf und im Ländle gilt, dass derjenige für die ewige Glückseligkeit
prädestiniert ist, der sein „Sach“ in Ordnung hält. Förderlich ist dabei
die soziale Kontrolle durch Nachbarn, was manchem nicht behagt.
Der Pietismus dagegen förderte die Freude am Tüfteln. Es war der
Pfarrer Philipp Matthäus Hahn, der in Kornwestheim „Erbauungs-
stunden“ abhielt, der zugleich als Mechaniker die Grundlagen für die
feinmechanische Industrie Württembergs legte. Als Johann Wolfgang
von Goethe 1779 mit seinem Dienstherrn Karl August ins Ländle reis-
te, wollte er unbedingt die Wundermaschinen des Pfarrers sehen. Da
für die Pietisten der Glaube und die weltliche Tüchtigkeit untrennbar
verbunden waren, wurden die Menschen im armen Württemberg zu
fleißigen Tüftlern und Erfindern. Jeder kennt die weltbekannten Fir-
men wie Daimler, Porsche, Bosch und Mahle. Doch überall im Ländle
finden sich höchst erfolgreiche Spezialisten und Start-ups, die es zur
Weltmarktführerschaft brachten. So erfährt der erstaunte Besucher
der Landesausstellung, dass das Streichholz, die Bohrmaschine, der
Leitz-Ordner, der Büstenhalter und der Trennschleifer, den meisten
unter dem Eigennamen „Flex“ bekannt, von Tüftlern des Neckartals
der Welt vermacht wurden.
Der Schwäbische Parnass
All das wären gute Gründe, sich bei den Schwaben umzusehen. Und
doch spielen diese Aspekte bei der Kulturfahrt von albaTours nur eine
Nebenrolle. Neben frommen Pfarrern und Tüftlern hat die Region
Dichter und Denker von Weltrang hervorgebracht. Von Friedrich
Schiller über Hegel bis Hermann Hesse und Martin Walser geht der
Reigen. Der Literaturhistoriker und Gründungsdirektor des Deut-
schen Literaturarchivs, Bernhard Zeller, nannte diese Dichterdichte
den Schwäbischen Parnass. Auch das ist eine Folge der Reformation,
die ein für Deutschland vorbildliches Schulsystem einführte. Wer dem
Lehrer oder Pfarrer auffiel, wurde auf das Seminar Maulbronn und ins
Tübinger Stift gedrängt, um danach auf Staatskosten Pfarrer zu werden.
Doch die meisten versagten sich dem Dienst auf der Kanzel wie Ke-
pler, Hölderlin, Uhland, Schelling und Hegel. Hölderlin, Schelling und
Hegel, die im Tübinger Stift in einem Zimmer wohnten, begeisterten
sich für die Französische Revolution und riefen
„Vive la liberté!“. Sie berauschen sich an Schillers
Räubern und am Evangelium Rousseaus.
Ein anderer Zögling des Stifts, Eduard Möri-
ke, unterzieht sich dagegen der „Vikariatsknecht-
schaft“, um überleben zu können. Hauptsache er
konnte dichten. So erzählen die Bauern von Och-
senwang, dass sich der Pfarrer, statt eine Predigt
vorzubereiten, ins Gras legte, um Verse zu schmie-
den. Er ließ sich auch nicht stören, als die Land-
wirte mit ihren Sensen anrückten, um das Grün-
zeug zu schneiden. Respektvoll mähten sie um ihn
herum, wofür die deutsche Literatur ihnen ewig
Dank schuldet.
Ein Merkmal des Pietismus ist es, dass sie die Bibel in ihren Zu-
sammenkünften (Schtond) selbst auslegten und ansonsten den Pfarrer
predigen ließen. Dies brachte sie in Opposition zur Landeskirche und
Obrigkeit. Dass der Protest gegen „Stuttgart 21“ solch hartnäckige
Formen annahm, führen viele auf die traditionell obrigkeitskritische
Grundstimmung der Pietisten zurück.
Schwaben – Barbaren, Revolutionäre, Schöngeister
Das Imperium schlägt zurück
Lateinschüler führt ihre erste Lektüre mitten in die aufregende
Konfrontation zwischen Caesar, glänzendem Feldherrn des Impe-
riums und Ariovist, König des wilden Barbarenstammes der Sueben.
Die Tricks, mit denen der schreibende Imperator seine Rolle als Held
steigert, kannte man schon in der Antike und werden bis heute in der
Trivialliteratur gepflegt. Der Gegner erscheint wild, mutig, aber doch
als wüst prahlender Barbar. Dabei war man ihm freundschaftlich ent-
gegen gekommen, hatte ihm den Titel
amicus populi Romani
verliehen.
Statt darauf stolz zu sein, bedroht er nun gallische Stämme, ebenfalls
„Freunde des römischen Volkes“, die sich hilfesuchend an Caesar wen-
den. Seine Drohungen lassen keinen Zweifel: „Caesar soll sich ruhig auf
einen Kampf einlassen. Er wird auf unbesiegbare germanische Helden
treffen.“ Solche
arrogantia
jagt einigen von Caesars kampferprobten Of-
fizieren einen ordentlichen Schrecken ein. Gerüchte kochen hoch, dass
schon der scharfe Blick der Barbaren (
acies oculorum
) die Feinde zer-
mürben könne. Nun kommen sie in Scharen zum Feldherrn und bitten
um Urlaub, nicht ohne vorsorglich ihr Testament aufgesetzt zu haben.
Dann schlägt Caesars Stunde. Er putzt die Offiziere vor versammelter
Mannschaft herunter, marschiert los und zerlegt das Heer des Barbaren
nach seinem bekannten Motto: veni, vidi, vici.
Sie kommen aus dem Baltikum
Können und wollen die friedlichen, „häuslesbauenden“ Bewohner
der Täler und Hügel entlang des Neckar ihre Ahnenreihe auf diesen
anmaßenden Barbarenkönig zurückführen? Eine Ausstellung im Alten
Schloss in Stuttgart ging im Frühjahr dieser Frage nach: „Die Schwa-
ben – zwischen Mythos und Marke“. Historiker gehen davon aus, dass
sich die Volksbezeichnung „Sueben“, wovon sich „Schwaben“ ableitet,
genauso wie „Alemannen“ nicht auf einzelne Stämme eingrenzen lässt.
Die Leute des Ariovist, mit Frauen und Kindern waren wohl Angehöri-
KULTURFAHRTEN
LITERATOUR
SCHWABEN
15.8.-20.8.2018
$
628 EZZ
$
70
Mit Schiller nach Marbach, mit Faust nach
Knittlingen, Hölderlin und Hermann Hesse
begleiten uns nach Maulbronn, Mörike erle-
ben wir an mehreren Stellen, unter anderem
in Bebenhausen. Casanova erzählt uns seine
Abenteuer in Stuttgart, wo Cotta der Verleger
Schillers und Goethes lebte. Nach Tübingen
kamen alle diese Geistesgrößen. BeimAusflug
auf die Schwäbische Alb ist Wilhelm Hauff
unser Begleiter.
Sechs spannende Tage voller Literatur in
Schwaben. Ausgangspunkt ist das malerische
Nürtingen, wo Hölderlin seine Jugend ver-
brachte.
Foto: fotolia/Manuel Schönfeld
40
Stolz auf diese Ahnenreihe
lässt den im Grunde bescheidenen
Schwaben
innbrünstig verkünden:
Der Schelling und der Hegel,
der Schiller und der Hauff,
die sind bei uns die Regel,
das fällt hier gar nicht auf.
Von Kunsthistoriker und Dichter
Eduard Paulus, 1897.
Grabkapelle auf dem Württemberg, Giovanni Battista
Salucci,1817 - 1839 königlich-württembergischer
Hofbaumeister.
















