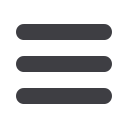

12
13
2018
In der Toskana war man schon immer einen Schritt voraus. Während die christliche Welt
sich noch mit den sperrigen römischen Zahlen abquälte, führte hier ein Mönch, der gleichzeitig ein
genialer Mathematiker war, die indisch-arabischen Ziffern mit der genialen Null ein.
schen eines Staates zu Debitoren (lat. debere = schulden) wurden. Diese
Idee hatten die Griechen, die sämtlichen „Partnern“ in ihrem Attischen
Seebündnis, den „Zehnten“ für die Göttin Athena zwangsauferlegten.
Dafür ersannen ihre Kassenbuchhalter die Logisthai. Damit war die
Buchhaltung geboren, ohne die auch die kleinste Firma heute nicht aus-
kommt. Auch für Kaiser Karl den Großen war es wichtig zu erfassen,
was seine Krongüter und Reichshöfe so abwarfen. Dafür erstellte die
königliche Kanzlei sogar Musterformulare. Kanzleien kannten übri-
gens schon die Baumeister der romanischen Kathedralen. Damit diese
konzentriert und ungestört arbeiten konnten, zimmerten sie sich in der
Ecke des Kirchenbaus einen „Holzverschlag“. Genau das bedeutet das
Wort cancellus. Der Chef dieser Buchhaltung war der cancellarius, wo-
von unser Wort Kanzler abgeleitet ist.
Leonardo da Vinci und der Vater der
Doppelten Buchführung
Doch denDurchbruch brachte ein toska-
nischer Mönch mit der doppelten Buch-
führung. Diese war aber erst möglich,
weil ein Mann aus Pisa die indisch-ara-
bischen Zahlen eingeführt hatte. Le-
onardo Fibonacci, Rechenmeister aus
Pisa, hatte diese als Konsul in Algerien
bei den Muslimen abgeschaut. Konsuln
waren Leute, die sich in den Ländern, mit
denen man Handel trieb, gut auskannten.
Sie gaben den Kaufleuten, die nicht unbe-
dingt für die fremde Kultur offen waren, oft die
entscheidenden Tipps. Daher ihr Name Konsuln, von
lat. consulere = einen Rat geben. Sofort machten die Kaufleute sich
diese bequeme Art des Kalkulierens zunutze, trugen aber die Summe
mit römischen Ziffern in die oberste Zeile ein (summa = die oberste).
Sonst hätte man ja den Ungläubigen zugestanden, den Christen voraus
zu sein.
Da schon für die Baumeister der großen Kathedralen die Buchhal-
tung wichtig war, wundert es nicht, dass die Revolution in der Buch-
haltung aus der kirchlichen Ecke kommt. Schließlich mussten die Lie-
ferungen des Materials und die Abrechnung mit Künstlern, Arbeitern
und Fuhrleuten exakt dokumentiert werden. Luca Pacioli wurde 1470
Mönch des Ordens der Franziskaner. Dank seiner mathematischen Be-
gabung rief ihn Ludovico il Moro 1497 nach Mailand, wo er mit Leo-
nardo da Vinci zusammenarbeiten sollte.
Leonardo war bekanntlich ein schwieriger Typ, weshalb er seinem
Landesherrn die Gefolgschaft aufkündigte und nach Florenz ging. Nun
hielt es Luca Pacoli auch nicht länger und er ließ sich in Venedig nieder.
Dort schrieb er ein Buch über das Schachspiel (De ludo scachorum), für
das wohl auch Leonardo da Vinci Beiträge lieferte. Dieses Spiel war wie
die Zahlen von den Arabern aus Indien eingeführt worden. Nach einigen
weiteren sehr klugen Büchern über Mathematik und Algebra folgte das
Werk Tractatus de computis et scripturis (Abhandlung über das Rechnen
und Aufschreiben) mit den Grundlagen der Doppelten Buchhaltung.
In Europa kapiert man: Soll und Haben sind
immer gleich.
Die Idee war so einfach wie durchschlagend: Jeder Geschäftsvor-
gang wird in zweifacher Weise erfasst, jedoch auf verschiedenen Kon-
ten. Es wird zeitgleich jeweils genau der gleiche Wert im Soll und im
Haben gebucht.
Da das Buch sofort in viele Sprachen übersetzt wurde, verbreitete
sich die doppelte Buchführung sofort in ganz Europa. In Deutschland
firmierte diese Methode zunächst als „Venezianische Methode“. Der
Erfolg eines Unternehmens wird in der jeweiligen Bilanz des Vorjahres
mit der des aktuellen Jahres festgestellt. Bilanz kommt übrigens von ital.
Bilancia = Waage. Der Bestand auf den einzelnen Konten wird durch
das Ziehen von Salden ermittelt. Diese „fest“ zu stellen ist Aufgabe des
armen Buchhalters. Das ital. Saldo ist schließlich abgeleitet von lat. so-
lidus, was „fest“ bedeutet.
Und dann sage noch einer, Buchhaltung sei langweilig!
Städte
Gold statt Rindvieh
Gerade erleben wir wieder eine Revolution, die digitale, die letzte
in einer Reihe von Umwälzungen. Es war irgendwann im 6. Jahrhun-
dert v.Chr., als es den Menschen zu lästig wurde, alle Handelswaren
mitzuschleppen, um sie gegen ein passendes Produkt einzutauschen. So
hatten Kaufleute aus Lydien die Idee, statt Waren zu tauschen, Gut-
scheine in Form von Goldkügelchen auszugeben. Bald merkten sie, dass
die Goldkuller in ihren Beuteln zu viel Platz einnahmen und drückten
sie einfach flach. Nun brauchten sie nur noch ihr Logo einzuhämmern
und die Münze war geboren. Heute erinnert das englische Wort
fee
(Gebühr) daran, dass man früher Vieh tauschte. Ihr König war übrigens
der sagenhaft reiche König Krösus († um 541 v.Chr).
Kreditwürdigkeit
Auch dank der ausgeprägten Geldwirtschaft mit systematischer
Münzprägung konnte Rom sein Imperium über Europa ausdehnen. So
funktionierte das Verfahren fast zwei Jahrtausende bis ins Mittelalter:
Ware gegen Geld. Wenn aber ein Geschäftsfreund nicht gleich zahlen
konnte, musste man ihm das Geld vorstrecken, wenn man seine Sachen
trotzdem verkaufen wollte. Zwei Dinge waren Voraussetzung: Einmal
musste man daran glauben, dass der Schuldner seine Schuld wieder
zurückzahlen konnte. Daher kommt der Name Kredit (von lat. credere
= glauben). Ferner musste jemand den Vorgang aufzeichnen und von
beiden Partnern bestätigen lassen.
Ohne Buchhaltung keine Herrschaft
Das leisteten bereits die Händler des Zweistromlandes (Mesopota-
mien). Aufzeichnungen wirtschaftlicher Vorgänge gehören zu den äl-
testen Dokumenten der Menschheit, in Keilschrift auf Tontäfelchen,
lange vor Einführung der Geldwirtschaft. Irgendwann in der Ge-
schichte kam es, dass nicht nur die echten Schuldner, sondern alle Men-
FLORENZ
EIN TOSKANISCHER MÖNCH MISCHT
DIE WIRTSCHAFT AUF
„Summa de arithmetica“
Buch Luca Pacioli, 1494.
Luca Pacioli (1445 Sansepolcro -1517 Rom) war ein ital. Mathe-
matiker und Franziskaner. Bekannt ist er in den Wirtschaftswissen-
schaften, weil er 1494 als erster die doppelte Buchführung komplett
beschreibt. Porträt gemalt von Jacopo de Barbari, 1495.
Statue
Luca Pacioli
in Sansepolcro.
Foto: FotoEnit/tos
FOTOS:
Münze: Italien500Lire1994_bgvr_CC BY-SA 3.0
Statue:Statua-Luca-Pacioli-Sansepolcro_von K.Weise (Eigenes Werk) [CC
oben rechts: BY-SA 3.0 Jacopo_de'_Barbari_-_Portrait_of_Fra_Luca_Pacioli_and_an_Unknown_Young_Man_-_WGA1269
Buch: Titelbladet_till Summa de arithmetica_Stockholms Universitetsbibliotek_ CC BY 2.0
Foto: shutterstock/MaLija
















